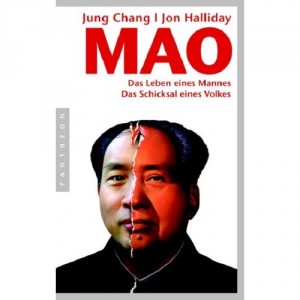Der eine nannte den anderen einen „Schakal und Wolf“, der andere ihn dafür postwendend „ein Stück Scheisse“. Zwei wahrhaft feine Herren. Der eine ist amtlich durchgeknallt, aber im weistesten Sinne harmlos, wenn auch ein selbstverliebter Diktator, der andere der wohl größte Massenmörder der Geschichte – mit einigem Abstand noch vor unserem Hitler.
Die Bestseller-Autorin (Wilde Schwäne) Jung Chang hat gmeinsam mit ihrem Mann Jon Halliday eine exzellent recherchierte und dokumentierte Biografie des Großen Vorsitzenden vorgelegt: Mao: Das Leben eines Mannes, das Schicksal eines Volkes, die wohl wirklich dazu angetan ist, die allzu vielen Märchen und Mythen zu zerstören, die sich um den Führer der chinesischen Revolution ranken.
Porträtiert wird ein machtbesessener, kühl taktierender, herrschsüchtiger und egomanischer Politiker, dem jedwede Idee, jedwedes Prinzip und jedwedes Leben von vornherein untergeordnet erschien unter sein einziges Ziel: die Macht zu erlangen, zuerst in China, dann in der Welt.
Mao Tse-tung hatte niemals eine profunde Idee vom Marxismus. Er klaubte sich aus dem Fundus, was in sein Konzept passte. Das allein wäre aber noch kein herausragendes Merkmal, denn alle Führer des Kommunismus haben sich an Marx bedient, wie es ihnen passte. Was man natürlich auch damit erklären kann, dass seinerseits der recht graue Theoretiker Marx in keine der real existierenden Welten passte.
Dass Mao sich an die chinesische kommunistische Partei anlehnte, rührt wohl am ehesten daher, dass die noch klein war – zur Gründung selbst kam Mao nicht angereist – und daher für ehrgeizige Politiker noch Platz bot. Die nationalistische Partei des Chiang Kai-schek wäre ihm genauso nahe oder fern gestanden, doch gab es in ihr bereits Apparat und Personal. Da war kein Platz für einen eher ungebildeten, obendrein faulen Bauernbuben aus Shaoshan in Hunan.
Von Beginn an schritt Mao über die Leichen seiner Untertanen Anhänger und Weggefährten hinweg, stellte Regeln mit den wohltönenden Worten marxistisch-leninistischer Phrasen auf, die er selbst nicht eine Sekunde lang gewillt war einzuhalten.
Den langen Marsch brachte er – im Gegensatz zu seinen Soldaten, Frauen und Trägern – über weiteste Strecken zu Pferd oder gar in einer Sänfte hinter sich. Den größten Teil des Marsches dankt die KPCh seiner mutwilligen Entscheidung, um eines Konflikts mit anderen Führern willen die ihm gebliebene Armee beim Vordringen in die falsche Richtung lieber aufzureiben als in eine Vereinigung mit anderen, ihm überlegenen Truppenteilen zu führen, wo er die Macht wohl hätte teilen oder abgeben müssen.
Taktierte er zunächst gegen die eigenen Genossen, übertrug er dieses Prinzip später auf seinen Konflikt mit Chian Kai-schek, den er lieber bekämpfte als die im Lande stehenden Japaner, nach Erringung der Macht in China gegen seine Förderer in Moskau – Stalin schäumte regelmäßig über den starr- und eigensinnigen Mann in Peking.
Gelungen ist Mao abseits der Eroberung ganz Chinas so gut wie nichts: sein Regime vermochte seine Bevölkerung nicht zu ernähren, die übermächtigen Anstrengungen rascher Industrialisierung kosteten Millionen das Leben und ließen verwahrloste Felder und funktionsuntüchtige Industrieruinen zurück; chinesische Kampfjets wurden in Serie gebaut, keiner davon flog – zu Lebzeiten Maos – jeweils auch nur einen Einsatz. Das Zeug wollte nicht einmal Kim Il Song.
Dafür machte Mao sich in der damals kommunistischen Welt beliebt, indem er billigst bis überhaupt kostenlos Tonnen von Lebensmitteln zur Verfügung stellte – die DDR nahm gerne, um daheim die Rationierungen aufheben zu können und so auch sie Normalisierung im Gefolge des Aufschwungs in der BRD mimen zu können. Währenddessen verhungerten die Bauern in Chinas traditionellen Korn- und Reiskammern zu Millionen.
Für alles und jedes vermochte Mao seine einzige wirkliche Ressource denn doch nicht ins Treffen zu führen: die unerschöpflichen Menschenmassen Chinas. Sein Angebot an Nasser, ihm mit Millionen von Freiwilligen-Soldaten auszuhelfen, ließ – was Nasser aber sofort sah – den Aspekt ihres Transportes nach Ägypten ausser acht. Zu logistischen Leistungen jenseits langer Fußwege waren die Chinesen unter Mao damals gar nicht in der Lage.
Dennoch versuchte Mao, sich als Führer der kommunistischen Welt zu gerieren, was ihn schon zu Stalin, mehr aber noch zu Chruschtschow und Breshnew in Gegensatz brachte.
Dafür ließ Mao an den schönsten Flecken Chinas abgrundhäßliche Bauten errichten, bei denen jedweder Luxus getrieben, alle Ästhetik aber dem paranoiden Sicherheitsbedürfnis des Vorsitzenden untergeordnet wurde. So wurden etliche prachtvolle Landhäuser klassischen Stils in Betonhallen verwandelt. Dort umgab er sich dann mit bevorzugt jungen Rotgardistinnen und regierte die meiste Zeit vom riesigen Bett aus.
Geblieben ist vom Vorsitzenden Mao abgesehen von den noch immer im Schwange stehenden überlebensgroßen Porträts die unglaubliche Menge von 70 Millionen Toten in Friedenszeiten. Und ein oder zwei sich maoistisch nennende Befreiungsbewegungen, von denen man nur hoffen kann, dass der Tag der Befreiung nur im umgekehrten Sinne komme: von ihnen und ihren krausen Ideen. Die Verachtung, die Fidel Castro (von ihm war eingangs die Rede) dem Chinesen entgegen brachte, erweist sich in dieser Lektüre als wohlbegründet.