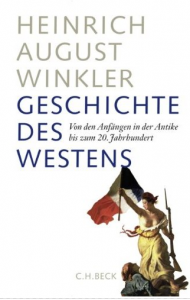Auf den ersten Blick ein in der Tat überfälliges Projekt: die Geschichte des Westens: Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert von Heinrich August Winkler liegt mit ihren exakt 1199 Textseiten und einem umfangreichen Apparat gewichtig in der Hand.
Bei näherer Betrachtung ist es aber zunächst einmal fraglich, was denn eine Geschichte des Westens ausmache: wie denn erstens der Begriff des Westens überhaupt zu fassen und wie zweitens seine Geschichte denn zu schreiben wäre.
In seiner Vorbemerkung spricht Winkler vom Fehlen einer gemeinsamen Geschichte des europäischen und des nordamerikanischen Raumes – woraus vielleicht ersichtlich wird, wie er den Begriff des Westens fasst, ausgehend von seinem letzten Projekt, einer deutschen Geschichte mit dem Titel Der lange Weg nach Westen.
Hatte nicht auch der angelsächsisch-französische Westen lange Wege zurück zu legen, um sein normatives Projekt, die Ideen von 1776 und 1789, hervorzubringen und, wie unvollkommen auch immer, zu verwirklichen? Gab es neben dem deutschen nicht auch bei anderen europäischen Ländern lange Wege nach Westen? Bedurfte es, wenn dem so war, nicht einer weiteren Untersuchung, um zu klären, was den vielfach gespaltenen Westen im Innersten zusammenhält?
So wird aber schon in der Vorbemerkung klar, dass es sich eben nicht um eine Geschichte des Westens sondern allenfalls um Geschichte im Westen handelt – eine Sammlung gleichzeitiger Geschichten unterschiedlicher Gesellschaften und Nationen, die mit langem Atem ausgebreitet werden.
Nicht dass die Langatmigkeit des Buches ein prinzipieller Fehler wäre! Winkler ist genau, detailgetreu und selbst an den Nebenschauplätzen um Präzision bemüht. Seine Geschichte des Westens ist eine hervorragende Materialsammlung und in ihrer kongenialen Zusammenstellung auch so etwas wie ein Protokoll der Entwicklung der parlamentarischen Demokratien dieses Westens.
Aber wie schon in der Vorbemerkung bleibt auch das gesamte Werk inmitten einer umfassenden multinationalen Geschichtsschreibung die eigentliche Geschichte des Westens schuldig. Der Leser vermag sich aus den ausgebreiteten Fäden diejenigen heraussuchen, die er oder sie für konstitutiv für den Westen hält – es ist ja alles da.
Winkler hingegen hat und verfolgt ein Programm nur am Anfang, indem er bis zu den alten Ägyptern zurückgeht und mit dem Auftreten des Monotheismus bei der (historisch nicht fassbaren) Figur des Moses seinen Westen wurzeln lässt, genauer: bei seiner Modifikation des kurzlebigen Aton-Glaubens unter Amenophis IV., der sich Echnaton nannte. Das ist denn doch ein gewagter Schritt für einen Historiker, aber gut.
Nun ist der Monotheismus gewiss ein Phänomen, das die gesamte Geschichte des von Winkler geografisch umrissenen Raumes Westen durchzieht – die Frage ist aber, ob es ihn auch prägt. Denn erstens ist der Monotheismus eine auch anderorts grassierende Seuche und nicht gerade dem Westen endemisch.
Und zweitens: ist denn nicht just die europäische Geistesgeschichte von der Renaissance an eine fortwährende Einführung anderer Götter neben dem einen, dem christlichen Gott? Das Herabziehen Gottes auf bloß eine Spielart von Wahrheit kann man auch als Abkehr vom Monotheismus interpretieren, denn oberste Prinzipien werden nach wie vor verfochten, nur eben mehrere nebeneinander.
Wollte man die Wurzel Monotheismus zumindest ex negativo gelten lassen, als Reibebaum der Konstituierung des Westens gewissermaßen, so ist Winklers zentrale Setzung des Jesuswortes
So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist
als Entwicklungsfaden eher hanebüchen. Winkler stützt seine Darstellung auf die Differenz zwischen weltlicher und geistlicher Macht und rekurriert immer wieder darauf.
Nun ist ja gar nicht von der Hand zu weisen, dass der Westen die besondere Eigenheit eines heftigen andauernden Konkurrenzverhältnisses zwischen Papst und weltlicher Macht aufweist – zunächst des römischen, dann des mittelalterlichen deutschen Kaisers und schlussendlich einer Reihe regionaler Monarchen. Über lange Jahrhunderte ist die Ablösung von der Macht der Kirche der Antrieb verschiedener Entwicklungsbewegungen, und nicht nur politischer Natur.
Es ist ja wohl nicht das weltliche Machtstreben, das eines Jesuswortes bedurfte, die weltliche Macht dominiert in Ostrom und auch in anderen angrenzenden Reichen. Ergo könnten nur das römische Papsttum und sein Streben nach weltlicher Beherrschung seine Wurzel dort herleiten, was aber doch wohl eher widersinnig wäre. Ferner steht das Jesuswort auch in den orthodoxen Überlieferungen und hat in Griechenland oder Russland keineswegs vergleichbare Auswüchse gezeitigt.
Das Papsttum – und mit ihm die gegen es gekehrte Reformation als bloße Kehrseite derselben Medaille – bietet aber zweifellos einen Ansatzpunkt für eine Erklärung der spezifisch westlichen Geschichte. Seine Verselbständigung in eine territoriale Einflussgröße inmitten der Wirren der Auflösung des weströmischen und des nachfolgenden langobardischen Reiches sowie der fortwährenden italienischen Viel- und Kleinstaaterei kann als der Sonderfall angesehen werden, der einen Unterschied in der Geschichte des Westens konstituiert.
Winklers Buch ist dort glaubwürdig, wo es sich auf die akribische Darstellung der Fakten stützt. Es wirkt dort nachgerade banal, wo es Leitlinien in einer Geschichte des Westens ausfindig zu machen sucht – der Rückgriff auf Moses und Jesus ist allenfalls naiv.
Vielleicht ist auch die Frage nach dem Westen eine eher philosophische oder in unterschiedlichen Ausprägungen politische als eine bloß historiographische. Doch ohne eine Definition, was der Westen ist und was ihn konstituiert, ist es unmöglich, mehr als Geschichte im Westen zu schreiben – das aber ist Heinrich August Winkler durchaus geglückt.