Die Französische von 1789 war beileibe nicht die erste Revolution der Geschichte, doch stellt ihr Fortgang von der gerechten Empörung durch die Paranoia der äusseren und inneren Bedrohung in den Terreur und schlussendlich die Diktatur eine paradigmatische Entwicklung dar: Revolutionen kommen nicht von ungefähr – wenn man vielleicht die kubanische einmal aussen vor läßt – und treffen durchaus auf signifikante Unterstützung; sie bieten einen in der Verzweiflung als gangbar erscheinenden Lösungsansatz.
Dass sie dann nahezu immer – und die einzige rühmliche Ausnahme ist dabei die Amerikanische Revolution, die aber in Wahrheit ein Freiheitskrieg einer Kolonie war – in eine Diktatur münden, welche die ursprünglichen Ziele alsbald pervertiert, scheint eine der wenigen echten Berechenbarkeiten der Geschichte zu konstituieren.
Dafür können natürlich die Revolutionen als solche, als Bewegungen von mehr oder weniger grossen Massen, nicht wirklich etwas; es sind wie immer die zentralen Akteure, die Menschen mithin, die für die Pervertierung der Gedanken sorgen.
Dabei gibt es jedoch einige Verhaltens- und Ablaufmuster: wenn zunächst etwas errungen wurde, dann natürlich gegen jene, die zuvor zur Macht und ihren Trögen Zutritt hatten. Von ihnen gibt es Widerstand und sie suchen naturgemäß Verbündete – ebenso naturgemäß wappnet sich die Revolution gegen diese Bedrohungen. Und eine äussere ist allemal ein stärkeres Argument als eine innere, wenn es darum geht, für die Revolution zu mobilisieren.
In der Regel aber schwemmt die Umwälzung Leute an einflussreiche Positionen, die ihre eigenen Süppchen kochen – Lenin wäre hier nur das plakativste Beispiel, der mit der Februarrevolution noch gar nichts zu tun hatte, aber rasch die Entwicklung zu nutzen begann, um seine persönliche Herrschaft zu etablieren. Dabei ist es unerheblich, welche Theorien und Floskeln zur Anwendung kommen und ob irgendjemand unter den treibenden Kräften tatsächlich an sie glaubt.
Am Ende dieser revolutionären Entwicklungen steht, wenn sie nicht doch noch niedergeschlagen werden, eine Diktatur – und ein Volk, das sich beginnt, nach der Zeit vor der Revolution zu sehnen. Da aber scheint eine unweigerliche Folge des Vergehens von Zeit zu sein: auch die DDR erscheint inzwischen vielen als nahezu paradiesisches Staatswesen. Man hat schon immer viel zu früh vergessen, was einen eigentlich zur Revolution getrieben hat.
Die Französische Revolution ist sozusagen der Prototyp, der Bauplan, einer revolutionären Veränderung. Nicht nur in ihren anarchischen und brutalen Phasen, auch in ihrem Endergebnis: ein starker Mann steht am Ende jeder Revolution, eine Diktatur, die zwar pro forma noch die alten Phrasen drischt, doch die alten Manieren sich längst wieder angewöhnt hat, im neuen Gewand eben. Und da die Franzosen keinen König mehr wollten, kriegten sie einen Kaiser, da die Russen den Zaren nicht mehr wollten, kriegten sie Väterchen Stalin, und die Reihe setzt sich dann über Mao, Ceausescu und Castro zu Konsorten wie Ortega, Morales und Chavez fort.
Was aber hat das alles mit ihm zu tun?
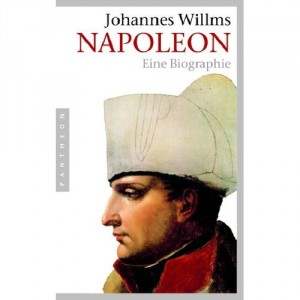
In Johannes Willms umfangreicher und gründlicher Napoleon-Biographie wird schnell klar, dass es auch dem bis heute insgeheim oder auch öffentlich beweinten Kaiser der Franzosen nur um sich selber ging.
Sein Aufstieg wurzelt in den Umbrüchen der Revolution, sein Weg an die Spitze ist geprägt von den Themen der Revolution, wiewohl sein wirkliches Ziel ein vollends gegenläufiges ist. Napoleon kümmert sich nicht darum, was gut für seine Untertanen ist, von seinen ersten Untergebenen bis hin zu seiner Grande Armee, die er in den weiten Russlands und Polens verbluten und erfrieren läßt, oder selbst der Grande Nation, seinen Franzosen. Sie sind Mittel zu seinen Zwecken.
Zum Glück überzieht nicht jeder Diktator gleich einen Kontinent mit Krieg und Verderben – aber auch die scheinbaren Operetten-Revolutionäre wie Castro oder Chavez spielen mehr oder weniger heiss mit dem Krieg. Der nämlich scheint ein probates und viel probiertes Mittel zu sein, das Feuer der Revolution am Brennen zu halten und zugleich Opposition wie übereifrige Revolutionäre hintan zu halten. Im Krieg stehen alle zusammen, er eint die Nation: das machte den Krieg immer schon populär – bei den Herrschern, und selbstredend bei den Diktatoren aller Couleur.
Napoleon ist davon wahrlich nicht das erste Beispiel in der Geschichte – doch er ist ein Prototyp für jene Egomanen, die umso leichter nach oben gelangen, je heftiger eine Revolution wütet. Die Ordnung und die Sicherheit, die sie nach den Wirrungen bringen, sind unerlässliche Grundlagen der Kriege, die sie im Schilde führen. Die Ausreden auf die äusseren Feinde und den Zwang der Lage folgen eingeschliffenen Pfaden der Herrschaftslogik, doch treibt diese Leute eine mächtige innere Feder, die gar keine anderen Auswege zulässt.
Revolutionen sind demnach notwendig, sonst würden sie gar nicht erst entstehen – aber sie tragen stets schon einige Generationen von Marat, Robbespierre, Danton und Bonaparte in sich – oder: Lenin, Trotzky, Stalin, wenn man will. Mit etwas Glück spielen sie in tropischen Ländern und kosten weniger Menschenleben.


