Nicht erst in Zeiten von verordneten Sparbemühungen in den öffentlichen Finanzen gehört die Frage nach der Gerechtigkeit – und implizit oder konterkarierend nach der Bedeutung von Gleichheit – zu den Themen mit zeitnaher Relevanz. Es sind Fragen von Verteilung und Umverteilung, respektive einer Beschneidung versus Ausweitung von Umverteilung, die sich heute mit Vehemenz stellen – jedoch schon weitaus älteren Ursprungs sind.
Dabei sind Vokabel im Gebrauch, deren Vernetzungen und Widersprüchlichkeiten und Weiterungen in andere Begriffsfelder denen am allerwenigsten klar zu sein scheinen, die sie im Munde führen. Im Kern wird dabei vor allem ein Mangel an Gerechtigkeit moniert, der aus einer wachsenden Ungleichheit in der Distribution von Ressourcen herrühre.
Es ist nun gewiss viel einfacher, Ungleichheit zu konstatieren als zu ergründen, worin eigentlich die durch sie verletzte Gleichheit besteht. Gerechtigkeit scheint folglich dabei das nachgeordnete Phänomen zu sein, das sich gleichfalls in Negation aus der Verletzung der Gleichheit ergibt. Wir haben es hier also nicht mit positiven Begriffen zu tun sondern mit Negationsmanifestationen von Unbekannten.
Eine typisch philosophische Reaktion darauf ist es natürlich, nach Auflösung der Negation die ursprüngliche Begrifflichkeit zu umgrenzen und möglichst normativ zu fassen.
Der Rechtsprofessor und Rechtsphilosoph Ronald Dworkin hat sich der Frage Was ist Gleichheit? ausführlich gewidmet und unterscheidet dabei eine Mehrzahl von Gleichheitsansätzen: die Wohlergehensgleichheit umfasst eine Familie von Konzepten, in deren Fokus eine Gleichverteilung nicht der Mittel sondern der Ergebnisse steht, mithin eine bis in die Verwirklichung hinaus gedachte Gleichbehandlung der Outputs; dagegen ist die Gruppe der Konzepte, die Dworkin unter dem Begriff der Ressourcengleichheit zusammenfasst, fast harmlos gefasst, da sie sich nur um die Seite der Verteilung bekümmert, mithin an einer Gleichverteilung der Inputs orientiert ist.
Die outputorientierten Gleichheitsmodelle werden von Dworkin rundweg – und aus nachvollziehbaren Gründen – verworfen: sie erweisen sich als äußerst sperrig in jedweder Hinsicht, von der definitorischen Fassung bis hin zu sämtlichen Umsetzungsansätzen.
Das zugrundeliegende Prinzip der Gleichheit als moralischer Forderung hingegen ist für Dworkin gewissermaßen selbstevident, allerdings bleibt er eine stichhaltige Begründung schuldig. Das ganze Buch geht stillschweigend davon aus, dass es um die Frage, ob Umverteilung zum Zwecke der Linderung von Ungleichheit als minimale oder zum Zwecke der Herstellung von Gleichheit als maximale Forderung eine Art von Naturgesetz oder Axiom wäre, das Ganze mithin lediglich eine Frage der Methodik und nicht grundlegender Natur, eigentlich keine Diskussion mehr zu geben braucht.
Ein Minimalkonsens könnte dabei sein: es gibt Mitglieder der Gesellschaft, die Förderung in ihrem Fortkommen gut gebrauchen können. Welche von ihnen und in welchem Ausmaß gefördert werden sollen, kann aber im einen Extrem ein Anspruch des Individuums, im anderen eine Gabe der Gesellschaft sein. Auf der Strecke zwischen diesen beiden Polen ist irgendwo der garstige Graben normativer Begründung zu überspringen, dessen erstere Position bedarf, letztere nicht.
Die Deklaration der Menschenrechte wird gemeinhin als das bindende Begründungsdokument der Gleichheitsdiskussion verstanden, wenngleich sich darin keinerlei Definitionen finden, die sich auf die hier diskutierte Frage anwenden ließen. Die einzelnen Artikel weisen auf den Ansatz einer Mindestversorgung der Individuen hin, die ihnen ermöglichen soll, den Geist dieser Deklaration auch zu leben – andernfalls sie sinnlos wäre.
Der nächste Schritt der Normensetzung, der hier stillschweigend vollzogen wurde, ist jedoch gravierender, indem eine eindeutige Wahl getroffen wird zwischen den Optionen, einerseits das Mindestmaß an Ressourcen zu definieren, mithilfe dessen jedem Individuum die Teilnahme an den Menschenrechten in deren Geist ermöglicht wird, und andererseits einer wesentlich darüber hinaus gehenden Forderung nach Gleichheit. Dieser letzte Schritt wird – so scheint es – in Gestalt einer Gegenfrage genommen: welches Modell denn sonst als Gleichheit?
Hier ist, ganz unabhängig davon, ob man es befürworten mag oder nicht, dass Gleichheit in der Zuteilung von Ressourcen oder dem Wohlergehen ein probates Ziel wäre, ein Mangel an Begründung festzustellen. Mit diesem schon klassisch zu nennenden argumentum e consensu geht Dworkin fluggs über in die Diskussion der Verteilung.
Es würde aber gewiss lohnen, dabei noch etwas zu verweilen. Nehmen wir einmal folgendes als gegeben: eine Gruppe von Ländern hat die Menschenrechte in der einen oder anderen konkreten Formulierung in ihre Grundgesetze aufgenommen. Als Bürger eines dieses Länder fühlen wir uns an diesen Grundkonsens gebunden und gestehen einem jeden Mitglied unserer Gesellschaft aus diesem Grund heraus ein Anrecht auf Ressourcen zu, die mindestens den Genuss dieses Rechtekatalogs ermöglichen.
Vorgeschaltet vor jedwede Diskussion von Details ist zu klären, was dem Status eines Mitglieds der Gesellschaft ausmacht; gemäß der Deklaration der Menschenrechte haben auch Flüchtlinge ein Anrecht auf diese minimalen Rechte, mit allerlei Verfahrenstricks wird allerdings versucht, sie so lange wie möglich aus dem Kreis der Berechtigten auszuschließen. Dies ein Beispiel dafür, wo konkreter Handlungsbedarf ohne weitere Spitzfindigkeiten und Debatten angebracht wäre. Das sollte eigentlich nicht einmal mehr eine Frage der politischen Entscheidungsfindung sein.
Eine Forderung nach Gleichbehandlung bei der Verteilung der Ressourcen dagegen geht über die bisher festgestellten Normen eindeutig hinaus. Ich würde der Selbstverständlichkeit dieses Schritts schon aus rein prinzipiellen Überlegungen die Gefolgschaft verweigern.
Wir leben in einem Land, in dem Umverteilung von Ressourcen eine täglich gelebte Realität ist: viele Steuern und Beiträge sind progressiv gestaffelt, sodass höhere Einkommen höhere Beiträge leisten, und viele Sozialleistungen werden am anderen Ende der Einkommensskala vergeben, was indirekt zum Effekt der Umverteilung führt.
Unzweifelhaft sind an dieser Situation zwei Dinge: erstens wir haben diese Rechtslage, weil wir noch nie eine Regierung gewählt haben, welche die Umverteilung von oben nach unten abgeschafft hätte, ergo ist sie als konsensual anzusehen und gesellschaftlich begründet – wir wollen es; und zweitens stammen die bestehenden Umverteilungen aus der gleichen über Wahlen und Regierungen gestalteten – wenn schon nicht unbedingt gemeinsamen so doch immerhin mehrheitlichen – Willensentscheidung, die aber keinerlei darüber hinaus gehende Definition oder Verpflichtung enthält. Mit anderen Worten: wir wollen es so.
Da es auch bei uns Egalitaristen verschiedener Färbungen gibt, sind alle möglichen Ideen schon einmal irgendwo diskutiert worden. Da es aber auch Anhänger gegenteiliger Ansichten gibt, wurden auch diese schon einmal irgendwo diskutiert. Aus beidem lässt sich nicht ableiten, dass eine dieser Ansichten zwingend wäre. Wir pflegen das in demokratischen Prozessen zu behandeln und jene Initiativen in Betracht zu ziehen, die sich als mehrheitsfähig erweisen.
Wo also könnte in dieser historischen Situation eine normative Setzung von Gleichheit für diese unsere Gesellschaft herkommen – außer vielleicht aus einem rhetorischen Taschenspielertrick?
Ließe sich vielleicht aus der rechtlichen Gleichheit eine ökonomische ableiten? Dabei landen wir nur wiederum beim bereits erwähnten Mindestmaß an Ressourcen, unterhalb dessen allein schon die ökonomische Lage eines Individuums die Teilhabe an den Rechten verunmöglichen würde, aber keinesfalls bei der Forderung nach genereller Nivellierung.
Aber sollten nicht, weil wir alle Menschen auf der Basis der gleichen Deklaration von Rechten sind, alle auch die gleichen Chancen erhalten? Dafür gibt es eine Reihe von guten Argumenten, aber leider gleichzeitig auch eine Reihe von Beharrungen, beide mit fundierter demokratischer Legitimation; und nicht einmal das ökonomische Argument, dass die offenherzige Nutzung dieses enormen Humanpotentials zum allgemeinen Wohl der Gesellschaft wäre, vermag mehr darzustellen als eben ein Argument in der politischen Debatte.
Bei der Chancengleichheit – die von Dworkin noch nicht einmal diskutiert wird – ist mit einer grundsätzlichen Bejahung noch nicht viel erreicht, denn die konkrete Ausgestaltung, welche Gebiete unter die gleich zu stellenden Chancen fallen und welche nicht und damit einhergehend die Festlegung von Gleichheitszielen und Vergleichsmethoden, ohne die es ja operativ zu keiner Gleichheit kommen kann, wäre ein Feld endloser Diskussionen. In gewissem Sinn befindet sich unsere Gesellschaft in einigen Bereichen mitten in dieser Diskussion, in anderen noch nicht einmal in einem Anfangsstadium, in keinem jedoch annähernd an einem Abschlusspunkt.
Das mag illustrieren, wie schwer und langwierig es ist, in einer konkreten Gesellschaft mit konkreten Mitgliedern gerade wegen ihrer demokratischen Verfasstheit etwas voran zu bringen. Dass diese Gesellschaft eingebettet ist in eine internationale Staatenwelt mit hoher wirtschaftlicher Integration, macht es nicht gerade einfacher, solche Fragen als Binnendiskussionen zu betrachten, vor allem, wenn Fragen der Ressourcenverteilung nicht unwesentliche Nebenaspekte makroökonomischer Natur aufweisen.
Dworkins Theorie dagegen ist fast gänzlich frei von solchen Realitätsbezügen. Das ist einerseits ein Kennzeichen aller normativen Begründungsversuche, selbst wenn die Maximen auf diskursiver Grundlage konstituiert werden sollen, andererseits steht jeglicher historischer Status Quo grundsätzlich in Widerspruch zur reinen Ableitung. Ausgangslagen sind niemals klar oder einfach sondern stets vertrackt.
Dworkin entwirft ein Vorgehensschema, das versucht, nicht nur eine Gleichverteilung von Ressourcen herzustellen, sondern die Gleichheit unter Einschluss berechtigender Defizite zu formulieren, durch welche etwa Menschen mit Behinderungen durch erhöhte Zuweisungen zu einem Ausgleich für diese Nachteile kommen sollen, sondern konstruiert dazu ein Vorgehen auf Basis marktwirtschaftlicher Mechanismen.
Es ist dieser Theorie der Gleichheit hoch anzurechnen, wie sie sich bemüht, die Auf- und Zuteilungen mittels bekannter und funktionierender Marktmechaniken herzustellen, etwa als ursprüngliche Auktion der Ressourcenpakete oder späterhin als Versicherungsmarkt zur Feststellung von Wertigkeiten von Defiziten und Kompensationen.
Das scheint grundsätzlich richtig gedacht und sehr um Fairness bemüht. Allerdings muss ein Ausgangspunkt, der verteilungsmäßige tabula rasa voraussetzt, von vornherein nutzlos. Wir sind keine Gruppe von eben gestrandeten Schiffbrüchigen – und unsre Welt ist keine bis auf uns menschenleere Insel, die wir nun nach Gutdünken verteilen können.
Sein Vorschlag zur Umsetzung in die Wirklichkeit umfasst ein komplexes System von Operationen auf einem hypothetischen Versicherungsmarkt, um Werte von Ressourcen festzustellen und aus diesen Pakete zu schnüren, die dem ursprünglichen Postulat der Gleichheit so nahe wie möglich kommen. Da in unserer realen Welt aber schon einfachere Dinge nicht demokratisch entscheidungsfähig sind, weil die Beschäftigung mit ihnen so starke Differenzen zutage fördert, die in keinem Diskussionsprozess reduziert werden können, selbst wenn es über grundlegende Aspekte eine Einigung zu geben scheint – an solche schrittweisen Vorgehen zu glauben, in denen von der Einigung über einen ersten Punkt deduktiv zum nächsten übergegangen werden kann, negiert vollends die Unverbindlichkeit demokratischer Zustimmung zu Prinzipien: sie gehen nämlich erst durch die gelebte Praxis an Einzelfällen in konkrete Ausgestaltungen über. Bis dahin sind solche Prinzipien – und darunter fällt auch die Akzeptanz der Menschenrechte – recht vage Lippenbekenntnisse des demokratischen Subjekts.
Selbstverständlich ist Dworkin das selber klar; aber wie alle kühnen Theorienbauer betrachtet er das als nachgeordnetes Problem. Zuerst die Begründung, dann die Umsetzung. Und darin ist der Grund zu sehen, warum alle solchen Konstrukte theoretische Fingerübungen bleiben müssen (um kein gröberes Wort zu gebrauchen). Dabei liefert er im abschließenden Kapitel über politische Gleichheit durchaus treffende Einblicke in die Spruchpraxis des Supreme Court der USA, in denen es um die Abwägung von Rechtsgütern gegeneinander geht, an welche ziemlich rasch klar wird, dass immer, wenn mehr als ein Rechtsgut im Raum steht, diese auch zu Konflikten neigen und einer Priorisierung bedürfen.
Können wir trotzdem aus solchen Theoriegebilden etwas lernen? Für die politische Praxis wohl kaum, da sie unter Verzicht auf autoritäre oder historische Begründungen auf eben die Sphäre des Politischen zurück geworfen sind, um überhaupt produktiv zu werden. Es handelt sich dabei um eine knifflige Ausgestaltung des Henne-Ei-Problems, bei dem man nur zu anderen Eiern zu gelangen vermag, indem man die Hennen austauscht.
Weder der Politiker noch der Theoretiker können sich jedoch das Volk aussuchen, das sie haben, noch können sie in der Regel überhaupt bedeutenden Einfluss auf den Fortgang der Geschichte nehmen; das ist nur wenigen vorbehalten.
Im Bereich der philosophischen Auseinandersetzung ist natürlich jeder Beitrag willkommen, aber man kann auch hier seine Bedeutung nicht direkt am Geschnatter der Philosophen ablesen. Ideen und Konzeptionen, die in dieser papierenen Welt einmal freigesetzt wurden, leben ewig – und das erweist sich an dem vermeintlichen Klassiker, der trotz vielfach erwiesener Irrtümer, genereller Nutzlosigkeit und einer katastrophalen Konsequenzenbilanz immer wieder Auferstehung feiert: Karl Marx. Aber das wäre eine andere Geschichte.

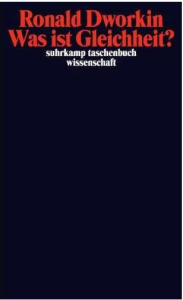


Ein Gedanke zu “Der ehrlichen Mühe kärglicher Lohn”