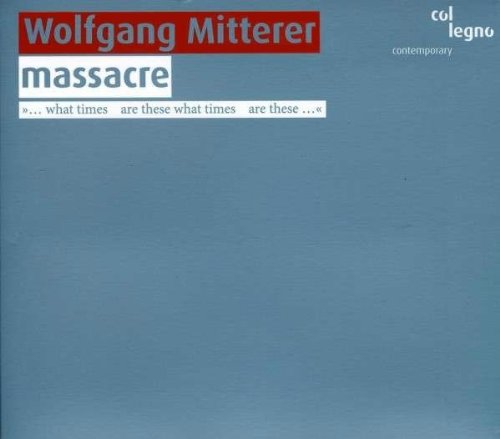Zum Auftakt der Saison bringt das Theater an der Wien gewissermassen eine riesige Menge an Talent in Anschlag auf eine Petitesse. Nicht dass des Herrn Nobelpreisträger Thomas Mann Novelle „Tod in Venedig“ das Problem wäre: sie ist eine böse kleine Satire, und eine wahre noch dazu, wenn man bedenkt, dass hier der vierzigjährige Großschriftsteller den späteren Klassiker vorweg porträtiert hat. Er mag’s im Geheimen befürchtet haben – oder wahrscheinlicher gehofft haben, mit der Niederschrift das drohende Problem seiner alten Tage zwischen Buchdeckel bannen zu können. Es ist ihm, das wissen wir, bei weitem nicht gelungen.
Umgekehrt liegt’s auch nicht an der Musik des bereits schwer kranken Benjamin Britten: er ringt mit dem Stoff, das ist über gewisse Strecken speziell im ersten Akt durchaus zu hören. Der Wurm steckt im Versuch, aus Mann’s Novelle eine Oper zu machen. Aber dahinter kommt man erst, wenn man so ziemlich durch ist. Und das ist echt mühsam.
Es gibt zwei Hauptdarsteller, von denen einer eine stumme Figur ist. Das kann auf dem Theater – wenn nicht grad Pantomime ist – nicht gut tun, und tut es natürlich auch in der Oper nicht. Gut, man kann den Part – wie in der Regie von Ramin Grey – gleich einem Tänzer anvertrauen. Das ändert aber nichts daran, dass die eine Figur in einer Tour unerwidert gegen die Wand singt. Nochmal gut: das steht so in der Novelle.
Im Text nicht und auch nicht in der Oper: keine Frauen. Es dürfen welche rumlaufen, ja, aber zu singen haben sie so gut wie gar nichts. Das hat Britten schon in Billy Budd so gehalten, warum auch immer. Es macht die Voraussetzungen des Unternehmens Death in Venice kein Bißchen besser.
In der Hauptrolle leistet Kurt Streit Großartiges – dafür, dass Britten ihm das alles allein aufgehalst und ihm dazu noch eine meistenteils besonders monotone Partie geschrieben hat, kann er ja nichts. Sonst gibt’s nur singende Statisterie – sie haben alle nichts beizutragen. Wiederum liegt das natürlich zum einen an der Geschichte, die ausser Statisten keine weitere Bevölkerung braucht, zum andern an Libretto und Komposition, die nichts vorgesehen haben.
Bemerkenswert einzig noch Bariton Russell Braun, der alle anderen halbwegs wichtigen Rollen zusammen spielt und singt. Es hätte sich wohl sonst nicht gelohnt, ihn zu engagieren.
Thomas schrieb, je älter er wurde, immer längere Texte mit immer weniger Menschen drin. Er mühte sich ab an der künstlerischen Sublimierung seiner peinlich strikt vor sich selber uneingestandenen Neigung zur Homosexualität. Die ganze ‚Tod in Venedig‘-Geschichte ist ein Paradebeispiel dafür. Das mag in den Worten von Ehefrau Katja – Frau Thomas Mann – harmlos klingen: der Dichter guckt halt auf Leute, an denen ihn was interessiert, was seine Figuren brauchen können. 1911 in Venedig aber sind ihm offenbar die homophilen Sicherungen heiß geworden, er hat das alles geflissentlich in den fast einjährigen Prozess des Novellenschreibens verschoben. Das gibt natürlich in der Regel auch keine tragfähige Grundlage her.
Die aus Hamburg übernommene Inszenierung ist so schül wie der Hintergrund der Geschichte, stellenweise sogar gräßlich seicht. Da retten ein paar vordergründige Metaphern wenig: etwa, wenn mittels Gebläse eine Stoffbahn wie ein etwas zu weicher, alter Phallus hochgeblasen wird und dann zusammensinkt, wenn der Protagonist wieder mal vom Jubel in die Tristezza stürzt.
Hier wird mit enormem Aufwand an Talent eine künstlerische quantité negligeable ans Licht der Welt gebracht. Da kann kaum wer was dafür, als dazumal derjenige, der sich in den Kopf gesetzt hatte, aus dieser Baustelle eine Oper zu machen, sowie diejenigen, die das heute noch auf die Bühne stellen.
Auf der Rückfahrt war dann die U-Bahn gesteckt voll mit Rapid-Anhängern. Die hatten einem ebenso sensationellen wie überraschenden Sieg ihrer Mannschaft beigewohnt und waren wohl schon einigermassen leergefeiert. Es ging recht gesittet zu, wenn auch im Dunst von Bier. So aber bleibe an mir, was sonst denen bleibt: mich der paar guten Momente zu freuen. Wenn es nicht um Fußball ginge, hätt‘ ich womöglich gern getauscht. Sagen wir, es war nichts.